
NIMBY
So wohlklingend dieses Akronym auch ist, so verheerend sind doch seine Auswirkungen auf den Wechsel hin zu erneuerbaren Energien und auch anderen, meist damit zusammenhängenden Themenbereichen. Wofür steht also NIMBY?
NOT IN MY BACKYARD
Auf deutsch: Nicht in meinem Hinterhof. Somit steht das Akronym für eine Abwehrhaltung gegenüber einem Projekt im direkten Umfeld einer Person, die im krassen Gegensatz zur eigentlichen Überzeugung dieser Person steht. Das Akronym kann auch für eben diese Personen selbst genutzt werden.
Ein Beispiel: "Die Bayern sind im Bereich der Windkraft absolute NIMBYs." Diese Aussage basiert auf Statistiken zum Windkraftausbau in Deutschland und aktueller Gesetzgebung in Bayern. Während in der bayrischen Politik Pläne für 800 neue Windkraftanlagen bis 2030 existieren (Augsburger Allgemeine), sorgen Gesetze wie die 10H-Abstandsregel (10x Höhe des Windrads bis zum nächsten Wohnhaus) nahezu für Stillstand beim Bau von neuen Windrädern. So wurden in Bayern 2022 gerade mal 3 Windräder errichtet, während 1 demontiert wurde. (Windbranche.de) Da braucht es keine große Rechnung um zu sehen, dass das Ziel bei diesem Tempo deutlich verfehlt wird.
Auch beim Bau von Infrastrukturprojekten wie neuen Stromleitungen, Bahnstrecken und Co. kommt es immer wieder zu NIMBYs, die eine Verzögerung der Projekte hervorrufen. Aber auch jeder, der schon mal Berührungspunkte mit kleineren, aber insbesondere auch größeren Projekten gehabt hat, wird eine ähnliche Problematik bereits beobachtet haben. Meistens sieht ein Großteil der Beteiligten die Umsetzung eines Projekts oder einer Veränderung als richtig und wichtig an. Trotzdem kommt es, sobald es konkret wird, zu Protest. Woher kommt dieser ablehnende Haltung plötzlich?
Es ist einerseits eine natürliche Abwehrreaktion des menschlichen Gehirns. Denn unser unglaublich "faules" Gehirn versucht, möglichst viele Vorgänge in unserem Alltag zu automatisieren, um weniger Aufwand zu haben. Auch ein gleichbleibendes Umfeld ist dafür förderlich. Eine Veränderung passt daher natürlich überhaupt nicht ins Konzept, da hierfür bereits automatisierte Prozesse angepasst werden müssen, was Energie und Aufmerksamkeit verlangt. Solange das Gehirn einen Vorteil für uns sieht, indem sich die äußeren Umstände durch die Veränderung verbessern, findet es die Veränderung toll. Sobald es dann jedoch selbst eine Veränderung vornehmen muss, kommt es zur oben beschriebenen Diskrepanz. Soweit der grobe psychologische Ansatz. (in Anlehnung an Change Leadership)
Andererseits hat dieser Protest seinen Ursprung auch in fehlendem Weitblick, der situationsbedingt ist. Denn bei persönlicher Betroffenheit durch eine einzelne Maßnahme rückt das große Gesamtbild schnell in den Hintergrund und die betroffenen Personen fühlen sich ungerecht behandelt. Es fühlt sich für sie danach an, als würden sie deutlich mehr belastet als der Rest der Gesellschaft. Für diese Problematik gibt es mehrere Lösungswege.
Der vermutlich beste Weg ist es dabei, Vorteile für die Betroffenen zu finden. Bei Windkraft- oder Solarprojekten kann dies beispielsweise durch eine finanzielle Beteiligung der Bürger:innen am Projekt und dessen Erfolg, oder aber auch durch Vereinbarungen mit der Gemeinde realisiert werden. Damit verknüpft ist aber auch der zweite, nahezu in jedem Projekt essenzielle Punkt, die Kommunikation. Je besser die Betroffenen über die Vor- und Nachteile eines Projekts informiert sind, desto leichter fällt es ihnen, den Sinn und die Notwendigkeit des Projekts nachzuvollziehen. Besonders bei finanzieller Beteiligung und anderen persönlichen Vorzügen, die einen direkten, positiven Gegenpol zu persönlichen Einschränkungen darstellen, ist eine umfangreiche Kommunikation hilfreich (weitere Informationen: Fachagentur Windenergie).
Diese Punkte gelten aber nicht nur für große Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien, sondern können auch auf kleinerer Ebene für Projekte in Unternehmen interessant sein. Klare Kommunikation ist grundsätzlich für alle Projekte absolut notwendig. Vielleicht findet man auch hier Möglichkeiten, den Beteiligten (oder auch Betroffenen) die für sie positiven Faktoren des Projekts herauszustellen oder im Konfliktfall solche zu erarbeiten. Denn es gibt kaum Mitarbeiter:innen, die eine Veränderung ablehnen, von der ein persönlicher Vorteil für sie ausgeht.
Auf dieser Basis möchte ich aber auch an alle Leser:innen appellieren: Wenn ihr euch in einer ablehnenden Haltung gegenüber einem Projekt befindet, ist euer Verhalten und eure Argumentation "NIMBY"? Hinterfragt, ob ihr gerade aus dieser grundsätzlichen und natürlichen Abwehrreaktion heraus handelt und argumentiert, oder ob eure Abwehrhaltung auch mit Blick auf das große Ganze gerechtfertigt und fair ist. Denn unser Gerechtigkeitssinn kann uns bei persönlicher Betroffenheit schnell fehlleiten.
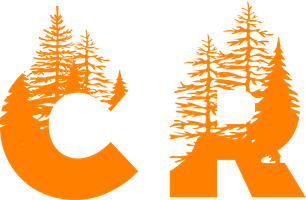
 By Clemens Richardt
By Clemens Richardt
Comments